Als ich am Abend von Dublin aus in Ardara ankam und mein Cottage bezogen hatte, war klar: Jetzt sollte der Irland-Trip richtig beginnen. Und wo ginge das besser als in einem Pub. Ich steuerte direkt das The Corner House an. Ein paar Locals saßen am Tresen, im Kamin knisterte das Feuer. Nach einem Jahr Abstinenz bestellte ich mein erstes Pint Guinness, nahm einen kräftigen Schluck – und ließ den Abend genau dort ausklingen, wo man in Irland gut ankommt.
Hinein ins Glengesh Tal
Die erste Tour am darauffolgenden Tag führte mich zunächst zu den Assaranca Waterfalls (Eas a’ Ranca). Von dort setzte ich meinen Roadtrip fort – hinein in das Glengesh-Tal und hinauf zur Passhöhe des Glengesh Pass. Hier windet sich die schmale Straße in engen Kurven durch eine unvergleichliche Hügellandschaft, bis man schließlich die Passhöhe erreicht.

Je höher ich kam, desto schwindelerregender ging es talseitig bergab – und zwischen diesem Abgrund und dem Auto fehlte natürlich jede Leitplanke. Vor jeder Kurve hatte ich das feste Bedürfnis, ein Stoßgebet gen Himmel zu schicken. Auch deshalb, weil die Iren nun mal verrückte Autofahrer sind. Sicherlich sind sie die schmalen Straßen gewohnt, sie haben ihre Fahrprüfung vermutlich genau hier absolviert und sind auf Linksverkehr sozialisiert. Und wahrscheinlich rasen sie gerade deshalb über die schmalen Straßen und durch die engen Kurven, allem kontinentaleuropäischen Sicherheitsdenken zum Trotz.
Straßen ohne Mittelstreifen
Jedes Mal, wenn mir auf diesen Straßen ein Ire entgegenkommt, ziehe ich mich instinktiv zusammen, mache mich so schmal wie möglich und lenke mein Auto bis fast über den Straßenrand hinaus, in der Hoffnung, dass wir beide heil aneinander vorbeikommen. Sollte es einmal nicht klappen, wäre die Situation versicherungstechnisch ohnehin der reine Wahnsinn. Denn auf diesen Straßen, auf denen man vermutlich aus Platzgründen auf einen Mittelstreifen verzichtet hat, wäre die Schuldfrage schlicht unlösbar. Deshalb ein gut gemeinter Rat an alle, die einen Roadtrip durch Irland planen: Unbedingt eine Vollkaskoversicherung abschließen.
Nachdem ich auf der Passhöhe kurz innegehalten, meine heile Ankunft gefeiert und die Aussicht genossen hatte, setzte ich meine Fahrt fort. Hinein in eine unwirtliche, offene Hochebene, geprägt von Torfmooren, kleinen Seen (Loughs) und einsamen Farmen. Mein Ziel: Glencolmcille, wahrscheinlich das abgelegenste Dorf am Rande dieser Welt. Aber was sich hier vor nun 75 Jahren ereignete, ist schlicht und einfach ergreifend.

Glencolmcille und der Manager im Talar
Damals zählten das Dorf und die umliegende Region zu den ärmsten Gegenden Irlands. Bereits seit dem 19. Jahrhundert war das Land – und besonders Donegal – stark von Abwanderung geprägt. Nach der Großen Hungersnot zwischen 1845 und 1852 verließen ganze Familien, sofern sie überlebt hatten, ihre Heimat. Viele gingen nach Amerika, nach Kanada oder irgendwohin, wo Arbeit und Hoffnung greifbarer schienen. Auch im 20. Jahrhundert änderte sich daran wenig. Die Landwirtschaft war kaum rentabel, Arbeitsplätze rar, Zukunftsaussichten für junge Menschen praktisch nicht vorhanden. In manchen Dörfern blieben nur noch die Alten zurück – die Jungen waren fort, in die Städte oder nach Übersee. Und sie kamen nicht mehr zurück.

Als Father James McDyer 1951 aus dem fernen Dublin als Dorfpfarrer nach Glencolmcille kam, fand er eine Gegend vor, die am Rand des Vergessens stand – arm, entvölkert und erschöpft von Jahrzehnten der Not. Schnell erkannte er, dass fromme Worte und Predigten von der Kanzel herab den Menschen kaum Hoffnung gaben – und an ihrer Situation erst recht nichts änderten.

Also stellte er die Selbsthilfe über seinen rein geistlichen Auftrag und nahm sich drei Dinge vor: die Menschen zu sozialen Kontakten zu ermutigen, ihren Alltag mit den Errungenschaften der Moderne zu erleichtern und durch wirtschaftlichen Aufschwung das Überleben der Gemeinschaft zu sichern. Er ließ ein Gemeindehaus errichten, organisierte Tanzabende und Weiterbildungskurse – und langsam begann das Gemeinschaftsgefühl zu wachsen. Darauf aufbauend gruben die Menschen Wasserleitungen, brachten Elektrizität in ihre Häuser. Parallel dazu entstanden neue Arbeitsplätze. Und nach und nach verebbte auch der Strom der Abwanderung.
Seit den 1960er-Jahren ging es mit der wirtschaftlichen Entwicklung spürbar bergauf. Die Menschen etablierten ein florierendes Genossenschaftswesen: landwirtschaftliche Betriebe, eine Konservenfabrik mit angeschlossener Fischverarbeitung und eigener Kutterflotte. Sie bauten ein Hotel, gründeten Handwerksbetriebe und organisierten den Vertrieb ihrer Produkte selbst.

Als Manager im Talar stieß McDyer bei seinen kirchlichen Vorgesetzten jedoch auf wenig Gegenliebe – nicht zuletzt, weil er Ansichten vertrat wie: „Sozialismus entspricht dem Christentum, und Kapitalismus ist das Gegenteil.“ Doch er sollte mit seiner „etwas entrückten Gesinnung“ recht behalten. Mit der Zeit waren rund 1.700 Menschen – nahezu alle Einwohner:innen der Umgebung – direkt oder indirekt in den Genossenschaften aktiv: wirtschaftlich abgesichert und mit einem neuen Vertrauen in ihre eigene Zukunft.
Die Klippen von Slieve League

Mit dieser Erkenntnis – und einem erhabenen Gefühl, das mir neuen Mut für unsere Arbeit in der VISO gegeben hat, der im Alltag manchmal ein wenig zu verblassen droht – setzte ich meine Fahrt fort. Mein nächstes Ziel war der nahegelegene Silver Strand. Dort, zwischen Klippen, grünen Wiesen, Schafen und dieser ungemein schönen Bucht, ließ ich die Eindrücke dieses Ortes noch einmal sacken.

Von dort führte mich mein Weg weiter zu den Slieve League – oder Sliabh Liag, wie sie auf Irisch heißen. Laut irischen Tourismusinformationen gelten sie mit rund 600 Metern als die höchsten Meeresklippen Europas. Das mag so sein. Doch Höhe allein ist nicht alles. Nach meinem Empfinden fehlt ihnen jene Dramatik der Kerry Cliffs, die ich bislang als die eindrucksvollsten erlebt habe – besonders dann, wenn bei aufgewühlter Brandung die Gischt des Atlantiks mit voller Wucht an ihnen zerschellt.

Am Viewpoint angekommen – den man nach einem durchaus anstrengenden Marsch von gut einer halben Stunde zu Fuß erreicht – sang dort gerade jemand eine irische Ballade. Eine passendere Hintergrundmusik für diesen Ausblick kann man sich kaum wünschen. Man könnte von hier aus noch weiter hinaufwandern, zu den höchsten Punkten der Klippen. Leider – oder vielleicht auch zum Glück – trat ich diesen Weg nicht mehr an. Der Tag neigte sich dem Ende zu, und die Nacht wollte ich hier oben lieber nicht verbringen
Killybegs und ein Glas zum Abschluss
Der Abschluss meiner ersten Etappe führte mich nach Killybegs, einem Dorf mit dem größten Fischereihafen Irlands. Am Kai, mit Blick auf kleine Kutter und große Fangschiffe, kreisten die Möwen. In der Luft lag dieser typische Mix aus Fisch, Salz und Diesel – ein Geruch, der unmissverständlich klar macht, dass hier gearbeitet wird.

Von dort trat ich meine Heimfahrt nach Ardara an – nicht ohne zuvor in der örtlichen Brennerei noch eine gute Flasche Dark Silkie von Sliabh Liag Distillers mitzunehmen. Weich, mit Noten von gesalzenem Karamell und gebackenen Äpfeln, eingehüllt in einen Hauch von Pfeifenrauch. Ein Whiskey, der nach Irland schmeckt und ein Glas, das man sich am Kaminfeuer einfach gönnen muss.
Siehe auch: Roadtrips durch Donegal – Zwischen Regen, Wind und Guinnes.
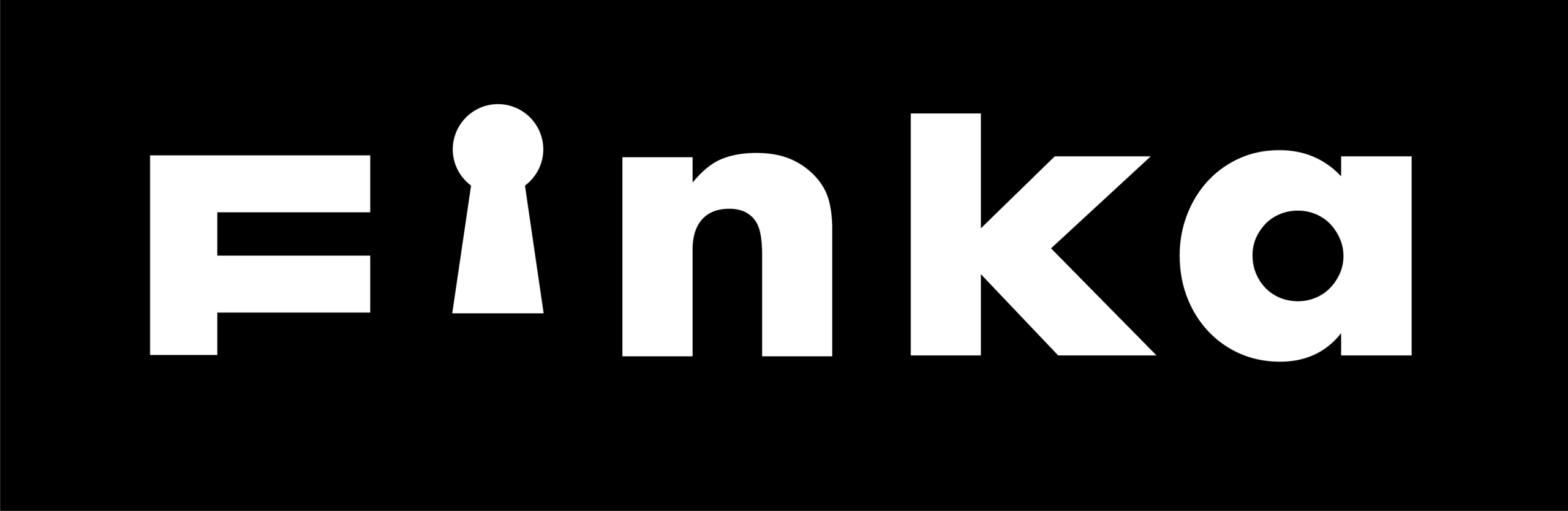

0 Kommentare